ALKOHOLFREI
- Ursula Hänni

- vor 5 Stunden
- 4 Min. Lesezeit
In Wollishofen gab es anfangs des 20. Jahrhunderts alkoholfreie Gaststätten, auf Fotos sind diese ab den 1920er Jahren erkennbar: ein Restaurant sowie mehrere Tea-Rooms und Cafés. Heutzutage finden sich keine solchen mehr, fast überall wird Alkohol ausgeschenkt. Was ist die Geschichte dieser Lokale?

1937, Seestrasse 404, Baugeschichtliches Archiv Zürich
Problem Alkohol
Alkoholexzesse wurden in der Schweiz ab Mitte des 19. Jahrhunderts vermehrt wahrgenommen, zurückzuführen wohl auf günstig verfügbaren Schnaps. Verschiedene Personen und Vereine beschäftigten sich mit den negativen Folgen, darunter die Medizin, aber insbesondere Frauen: Einige von ihnen litten unter dem Alkoholkonsum ihrer Ehemänner. Im Kampf gegen Alkoholismus agierten sie als Teil der sich formierenden Frauenbewegung. Auch in den Kirchen gab es Vertreter, die für die Alkoholabstinenz einstanden. Aus dieser christlichen Antialkoholbewegung entstand 1877 das Blaue Kreuz, welches den Kampf gegen den Alkohol auf seine Fahnen schrieb. Daneben gab es die «Guttempler», eine Abstinenzorganisation mit Wurzeln in den USA, die als Orden gegründet worden war und durch Auguste Forel in der Schweiz etabliert wurde.
Staatlicher Eingriff 1885
Die verschiedenen Stränge der Antialkoholbewegung generierten Druck: Eine Änderung der Bundesverfassung 1885 schuf die Grundlage für eine Alkoholgesetzgebung auf Bundesebene. Es gab eine neue Alkoholsteuer, wobei ein Teil der Steuereinnahmen für Massnahmen gegen den Alkoholismus eingesetzt werden mussten.
Auch im Bereich der Gaststätten tat sich einiges: Allen voran erwiesen sich der «Schweizerische Bund Abstinenter Frauen» und die «Bewegung für alkoholfreie Gaststätten» als wichtig. Letztere förderte und errichtete alkoholfreie Restaurants mit günstigem Essen und alkoholfreien Weinen. So entstanden ab den 1890er Jahren alkoholfreie Gaststätten und Volkshäuser. Auch die alkoholfreien Soldatenstuben des Schweizer Verbands Volksdienst (SV-Service), Kantinen, Wohlfahrtshäuser und vegetarischen Gaststätten waren mit ähnlichen Konzepten von «zeitgemässen, billigen, bekömmlichen Speisen» ohne Alkohol der Volksgesundheit verpflichtet. Ihre rasche Verbreitung bestätigte schon Ende der 1930er Jahre den Erfolg des im damaligen Europa einzigartigen schweizerischen Konzepts. Alkoholfrei waren auch die vom 18. Jahrhundert an entstehenden Milch-, Kaffee- (Café) und Teehäuser (Tea-Room).
Alkoholfreie Betriebe in der Stadt Zürich
Im Jahr 1900 gab es in Zürich bereits einige wenige Betriebe, allen voran das Alkoholfreie Kurhaus Zürichberg. Der Getränkehändler Berther & Co vertrieb alkoholfreie Getränke (Hochstrasse 35), die «Guttempler» hatten ein Restaurant an der Zeughausstrasse 31 – sie waren auch die Vertreter der Gesellschaft für Herstellung alkoholfreier Weine in Meilen. Paul Engeler-Baumberger an der Pelikanstrasse 8 war bei den «Frei-Templern» und im Geschäft mit Alkoholfreiem tätig, am Neumarkt 7 waren die Geschwister Fellenberg, sie führten ein «vegetar. alkoholfreies Speisehaus». Im Jahr 1915 sind im Adressbuch bereits deutlich mehr, nämlich bereits 38 solcher Gaststätten verzeichnet, die praktisch ausnahmslos von Frauen geführt wurden.
Alkoholfrei in Wollishofen

In nächster Nähe! Links das alkoholfreie Restaurant, rechts die rote Fabrik. Foto Baugeschichtliches Archiv Zürich, 1931
Vor 1800 gab es in Wollishofen bekanntlich nur ein offizielles Restaurant: eine Wirtschaft im Gemeindehaus, die als Taverne sowohl Essen und Trinken anbieten als auch Gäste über Nacht beherbergen durfte. Die Wollishofer Weinbauern durften zusätzlich ihren eigenen Wein ausschenken, sozusagen eine «Besenbeiz» betreiben. Von der Einführung der Handels- und Gewerbefreiheit anfangs des 19. Jh. wurde diese strenge Regulierung der Gastronomie wenig betroffen. Weiterhin war die Eröffnung von Wirtschaften (natürlich mit Alkoholausschank) stark reguliert, nur erlaubte die Regierung zunehmend mehrere Betriebe in den Dörfern (sog. Pintenschenken). Erst mit der Einführung der vollständigen Gewerbefreiheit 1865 wurden auch die Tavernenrechte grundsätzlich abgeschafft, diese Liberalisierung der Gastronomie hatte eine bedeutende Zunahme an Gaststätten im Kanton zur Folge, auch in Wollishofen (vgl. Blogbeitrag über die Wollishofer Lustorte)!
Ab 1920 ist das erste und einzige alkoholfreie «Nur-Restaurant» in Wollishofen an der Seestrasse 404 ausgewiesen, im Erdgeschoss der Greppi-Häuser. Es erstaunt nicht, dass es in unmittelbarer Nähe zur «roten Fabrik» eröffnet und von einer Frau – Alwina Stahl – geführt wurde. Inwiefern die Seidenweberei Stünzi in der roten Fabrik bei der Etablierung beteiligt gewesen war, wissen wir nicht. Aber es gab im Kanton Zürich verschiedene industrielle Betriebe, welche versuchten, den Alkoholkonsum ihrer Arbeiter einzudämmen: Die Chemiefabrik Uetikon beispielsweise gründete eine Sparkasse, damit die Familienväter bei Erhalt des Lohnes nicht gleich alles in Alkohol umsetzten sollten.
Das alkoholfreie Restaurant an der Seestrasse 404 in Wollishofen gab es gemäss Adressbuch der Stadt nur bis 1943. Ob der Krieg der Grund für die Schliessung war oder es mit dem Wechsel in der «Roten Fabrik» – von der Seidenweberei zur Telefonproduktion – zu tun hat, ist beides möglich.
In Wollishofen folgten ab den 1930er Jahren zudem Cafés und Tea-Rooms. Im Jahr 1968 sodann präsentierte sich das Telefonbüechli Wollishofen von Hans Schürch folgendermassen:


1968 waren also nur noch drei Cafés explizit alkoholfrei:
· Café H. Aeschlimann an der Widmerstrasse (vgl. Blogbeitrag FRÜHSOZIALISTEN)
· Café «Regina» (heute Medina), vgl. Blogbeitrag GEWERBE 1953)
· Café Rondo, Albisstrasse 108, bei der Tram-Endstation: Dieses war 1931 beim Bau des Hauses eröffnet worden und wechselte den Namen von ursprünglich «Tea-Room Rondo» (vgl. Foto) zu Café Rondo und dann zu Café Wollishofen. Seit kurzem ist es ein indonesisches Restaurant.

Albisstrasse 108, Tea Room Rondo, ca. 1935, Baugeschichtliches Archiv Zürich
Alkoholfreier Wein
Alkoholfreier Wein für Zürich wurde zu einem grossen Teil in Meilen hergestellt.

Die direkt neben dem Bahnhof Meilen gelegene und bereits 1896 eröffnete Produktionsstätte wurde 1928 von der Migros aufgekauft, welche drei Jahre zuvor gegründet worden war. Bis heute werden dort Lebensmittel produziert, seit vielen Jahren Süsswaren und -gebäck. Migros-Gründer Duttweiler machte damals aus der Not eine Tugend. Die Not: Der Kauf der «Alkoholfreien Weine AG Meilen», der ersten eigenen Produktionsstätte, hatte die Finanzen arg strapaziert. Die Tugend: «Dutti» übernahm das Engagement der Firmengründer, die sich dem Kampf gegen den Alkohol verschrieben hatten, und kurbelte über seine Kanäle den Verkauf von alkoholfreien Getränken an – erfolgreich. Und obwohl immer wieder zur Disposition, werden bis heute in Migros-Filialen keine alkoholischen Getränke verkauft.

Spannend finde ich, dass der Wollishofer Obst- und Weinbauer Albert Hausheer (mein Ur-Urgrossvater) regelmässig und direkt seinen Kundinnen und Kunden Wein verkaufte, den er selber anbaute. Andererseits wissen wir aus seinem Journal der Jahre 1899 bis 1920, dass er Anteilscheine der Alkoholfreien Weine AG in Meilen besass! Vielleicht war dies ein zusätzlicher Kanal zum Verkauf seiner Produkte? Jedoch dürfte er als religiöser Mensch auch grosses Verständnis für die christliche Abstinenzbewegung gehabt haben.
Alkohol und Jugend Auch in ein SJW-Heft (Schweizerisches Jugendschriften-Werk) fand die Thematik Eingang:

Aus: SJW-Heft «Alle lachten», ca. 1950
Und heute?
Liberalisierungen bezüglich Alkoholverkauf und Wirtepatenten und ein verändertes Lebens- und Trinkverhalten führten dazu, dass alkoholfreie Restaurants nach und nach verschwanden und heutzutage auch in Cafés Alkohol ausgeschenkt wird. Das bedeutet nun leider nicht, dass Alkohol kein Problem mehr wäre – im Gegenteil. Aber den Folgen der «Volksdroge Nr. 1» muss auf ganz verschiedenen Ebenen begegnet werden. Eine grosse Aufgabe!
Ursula Hänni
Quellen:


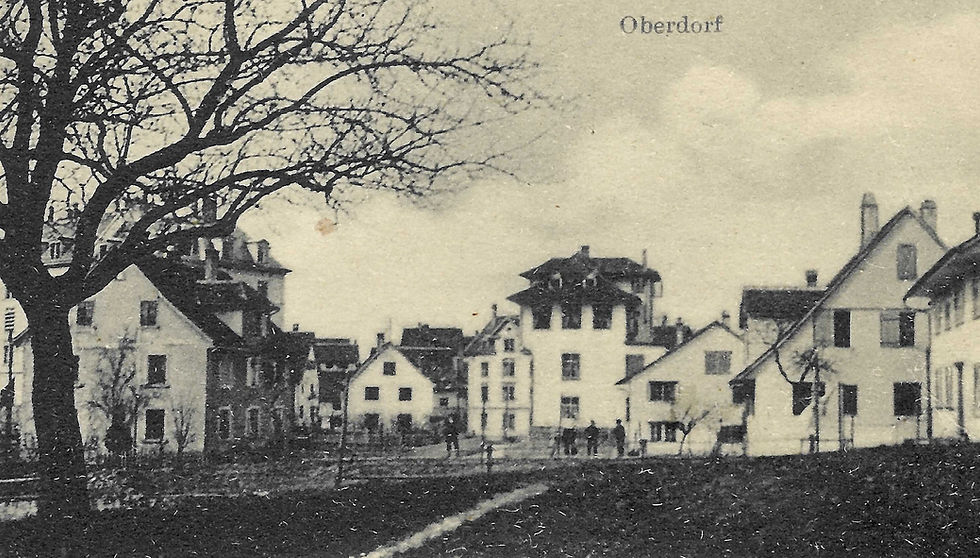

Comments